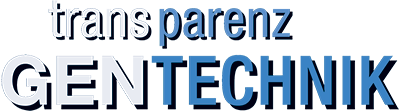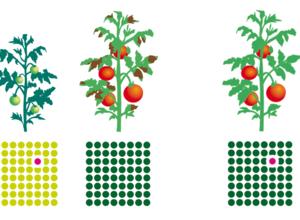Von Gift und Genen. Die Züchtung der Lenape-Kartoffel
Gentechnisch veränderte Pflanzen – das bedeutet Risiken und Ungewissheit. Konventionell gezüchtete Pflanzen sind dagegen “von Natur aus” sicher. Dass es so einfach nicht ist, zeigt der Fall der Lenape-Kartoffel.
Die Lenape-Kartoffel, die in den 1960er Jahren entwickelt wurde, lieferte verdammt gute Fritten. Leider war sie auch giftig. Kartoffeln zu frittieren ist eine knifflige Angelegenheit. Ob das Ergebnis stimmt, hängt nicht nur von den Fähigkeiten des Kochs ab, sondern auch von der Kartoffel selbst. Festkochende Kartoffeln – mit hohem Zuckergehalt und niedrigem Stärkegehalt – bräunen etwas zu schnell, weil der Zucker durch die Hitze verändert wird. Bis das Innere gar ist, ist das Äußere zu einer Kruste verbrannt.
Gute Kartoffelchips stammen aus Kartoffeln mit einem hohen Stärkegehalt. Aber um die richtige Farbe zu bekommen – dieses perfekte Goldbraun – muss man viele verschiedene Faktoren berücksichtigen, von den Zuckerarten, die in der Kartoffel vorhanden sind, bis zu den chemischen Prozessen, die ablaufen, während die Kartoffel nach der Ernte gelagert wird.
In den späten 1960er Jahren züchteten Wissenschaftler vom US-Landwirtschaftsministerium, der Universität von Pennsylvania und der Wise Potato Chip Company gemeinsam eine ganz besondere Kartoffel, die sie Lenape nannten. Über dreißig Jahre später denkt einer ihrer Kollegen immer noch liebevoll an diese Knolle zurück. “Lenape war wunderbar,” sagte 2003 der Wissenschaftler Herb Cole von der Penn State der Journalistin Nancy Marie Brown. “Sie lieferte goldene Chips.”
Ja, Lenape lieferte verdammt gute Kartoffelchips. Leider war sie auch giftig.
Trotz ihres langweiligen Rufs als das Weißbrot unter den Pflanzen hat die Abstammung der Kartoffel es in sich. Ihre nächsten Verwandten – Tomaten und Auberginen – sind harmlos. Aber unter ihren weiter entfernten Cousins finden sich Tabak, Chili, Tollkirsche und der Stechapfel, der einen halluzinogenen Wirkstoff enthält.
Chemisch gesehen ist das eine Pflanzenfamilie, die einen umhauen kann. Die Nachtschattengewächse produzieren stickstoffreiche chemische Verbindungen, die als Alkaloide bekannt sind. Nikotin ist ein Alkaloid, ebenso Koffein, Kokain und eine Reihe anderer pflanzlicher Inhaltsstoffe, die Menschen jahrtausendelang konsumiert haben. Abhängig von der Dosis und vom jeweiligen Wirkstoff kann die Einnahme von Alkaloiden therapeutische, halluzinatorische oder tödliche Folgen haben.
Kartoffeln produzieren ein Alkaloid namens Solanin. Alle Kartoffeln enthalten es, es ist eine Eigenschaft und kein Problem – jedenfalls aus der Perspektive der Kartoffel. Genau wie andere pflanzliche Alkaloide ist Solanin ein natürlicher Verteidigungsmechanismus. Es schützt die Kartoffel vor Fraßfeinden, etwa dem pilzähnlichen Erreger der Kraut- und Knollenfäule, der für die irische Hungersnot im 19. Jahrhundert mit verantwortlich war. Je mehr Solanin eine Kartoffel enthält, desto weniger anfällig ist sie für solche Krankheitserreger. Wenn eine Kartoffelpflanze in eine unangenehme Situation gerät – zum Beispiel, wenn sie jung und verletztlich ist oder wenn ihre Knollen nicht von Erde bedeckt und damit Fraßfeinden ausgesetzt sind – kann die Solaninproduktion hochgefahren werden.
Das ist nicht unbedingt angenehm für die menschlichen Fraßfeinde der Kartoffel. Plötzlicher Frost beispielsweise kann das Wachstum der Knollen hemmen und das Wachstum von Beeren und Blättern anregen, das einem jüngeren Entwicklungsstadium entspricht und mit höheren Solaninkonzentrationen verbunden ist. Und wenn Kartoffeln nach der Ernte zu viel Sonnenlicht abbekommen, werden sie grün und produzieren ebenfalls mehr Solanin. Das ist übrigens der Grund, weshalb man keine grünen Kartoffeln essen sollte. Diese Knollen und vor allem ihre Schalen enthalten viel Solanin. Wie viel, ist unterschiedlich, aber es kann ausreichen, um den Magen in Aufruhr zu versetzen. Es kann auch zu einer schweren Erkrankung mit Erbrechen, Durchfall, Bewusstseinsverlust und Krämpfen führen. In sehr seltenen Fällen sind Menschen sogar gestorben, nachdem sie grüne Kartoffeln gegessen hatten.
Unsachgemäße Lagerung nach der Ernte war aber bei der Lenape-Kartoffel nicht das Problem. 1974, nachdem diese Kartoffeln aus der Produktion zurückgezogen und auf den Status von “Züchtungsmaterial” zurückgestuft worden waren, veröffentlichten Wissenschaftler des US-Landwirtschaftsministeriums die Ergebnisse eines Versuches, bei dem sie Lenape und fünf weitere Kartoffelsorten an 39 Standorten im ganzen Land angebaut hatten. Wachstums- und Erntebedingungen wurden sorgfältig beobachtet und der Solaningehalt von allen Sorten wurde verglichen.
Das Ergebnis: Lenape besaß eine genetische Veranlagung dafür, außergewöhnlich viel Solanin zu produzieren, unabhängig davon, was während des Wachstums und der Ernte geschah. Während beispielsweise die Sorte Russet pro 100 g etwa 8 mg Solanin enthielt, waren es bei Lenape fast 30 mg. Damit war sie resistent gegen viele Schädlingen. Das erklärte aber auch, warum einige der Leute, die sie als erste aßen – vor allem Züchter und andere, die damit beruflich zu tun hatten – von heftiger Übelkeit heimgesucht wurden.
Was Lenape aber eigentlich interessant macht, ist ihr warnendes Beispiel. Ich hörte zum ersten Mal von ihr durch Fred Gould, einem Entomologen an der North Carolina State University, den ich traf, als ich für das New York Times Magazine für eine Geschichte über gentechnisch veränderte Moskitos recherchierte. Er nahm Lenape als Beispiel für Risiko und Ungewissheit.
Häufig werden gentechnisch veränderte Pflanzen im Kontext von ungelösten Fragen wahrgenommen – eine gigantische Ungewissheit, mit der wir in dieser Art niemals vorher zu tun hatten. Gould sagte, es gibt die hartnäckige Vorstellung, dass ausschließlich gentechnisch veränderte Pflanzen unbeabsichtigte Nebeneffekte mit sich bringen können und dass es keine Möglichkeit gibt, diese Effekte abzuschätzen, bevor die ersten Verbraucher krank werden. Aber nichts davon stimmt wirklich. Konventionelle Züchtung, das simple Kreuzen einer existierenden Pflanze mit einer anderen, kann alle Arten von unerwarteten und gefährlichen Ergebnissen hervorbringen. Später fand ich heraus, dass Lenape auch deshalb so berühmt-berüchtigt ist, weil sie einen großen Einfluss darauf hatte, wie in den USA heute konventionell gezüchtete Pflanzen für die Lebensmittelproduktion getestet und bewertet werden.
Aus Sicht von Gould gibt es viel mehr Risiko und Ungewissheit in der konventionellen Züchtung als bei der gentechnischen Veränderung. Das liegt daran, dass man es bei der Gentechnik nur mit einem einzelnen Gen oder einigen wenigen Genen zu tun hat. Bei konventioneller Züchtung sind viel mehr Gene im Spiel und es gibt viel mehr Möglichkeiten für überraschende genetische Wechselwirkungen. “Man hat versucht, schädlingsresistente Kartoffeln zu züchten, und brachte ein ganzes Chromosom aus einer Wildkartoffel ein”, sagte er. “Wir haben Wechselwirkungen zwischen den Genomen von wilden und kultivierten Kartoffeln gefunden, die zu der Produktion potenziell giftiger Substanzen in der Kartoffel geführt haben.“
2004 berichtete ein Ausschuss der Nationalen Akademien der USA, das sich mit unbeabsichtigten gesundheitlichen Effekten gentechnischer Veränderungen befasste, dass konventionelle Kartoffelzüchter immer noch versuchen, den Solaningehalt der Blätter und Beeren ihrer Pflanzen zu erhöhen, um sie widerstandsfähiger gegen Schädlinge zu machen. Aus diesem Grund hat das US-Landwirtschaftsministerium eigentlich einen Grenzwert für den Solaningehalt neuer Kartoffelsorten empfohlen – aber dieser Grenzwert wird nicht konsequent durchgesetzt.
Es geht Gould nicht darum, dass gentechnische Veränderung besser ist als konventionelle Züchtung – denn das ist sie nicht. Vielmehr sind beide Werkzeuge – unvollkommene Technologien, die unbeabsichtigte Nebeneffekte auslösen können. Welche man auswählt, hängt davon ab, was man erreichen will. Aber man kann nicht sagen, die eine ist beängstigend und die andere ist sicher.
Großes Foto oben: iStockphoto
Diskussion / Kommentare
 Kommentare werden geladen…
Kommentare werden geladen…
Themen
Von: Maggi Koerth-Baker
Maggie Koerth-Baker ist Wissenschaftsredakteurin für das US-Onlinemagazin Boing Boing. Sie schreibt außerdem eine monatliche Kolumne für die New York Times und ist Autorin des Buches “Before the Lights Go Out” über die Zukunft der Energieversorgung. Der hier übersetzte Beitrag erschien unter dem Titel “The case of the poison potato” bei Boing Boing.