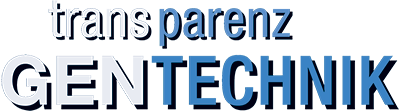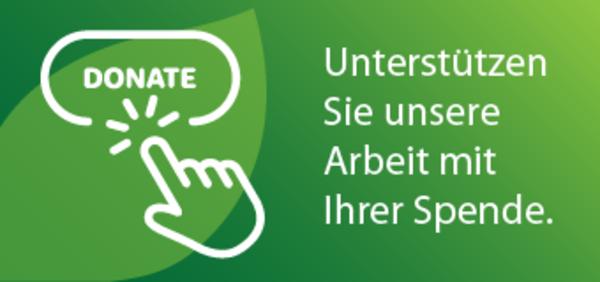Kaffee
| Forschung | Koffeinreduktion, Anpassung an Klimawandel, Pilz- und Insektenresistenz |
|---|---|
| Freilandversuche | EU: 1 USA, Indien, Französisch-Guyana |
Kaffee, eine ursprünglich aus Äthiopien stammende Pflanze, wird heute meist in tropischen und subtropischen Regionen kultiviert. Das wichtigste Erzeugerland ist Brasilien vor Vietnam und Kolumbien. 70 Prozent des Kaffees stammt aus kleinbäuerlichen Betrieben.
Von großer kommerzieller Bedeutung sind zwei Kaffeesorten: Arabica (Coffea arabica), eine empfindlichere Sorte höherer Lagen, und Robusta (Coffea canephora), eine widerstandsfähige Sorte aus Zentralafrika, die gut in tropischem Klima wächst. Während Arabica einen geschmacklich ausgewogenen Kaffee liefert, ist Robusta bitterer und wird vor allem für Instantkaffee verwendet. Rund 60 Prozent der Welt-Kaffeeerzeugung entfällt auf Arabica-Sorten, 40 Prozent auf Robusta. Hinzu kommen kleinere Mengen exotischer Sorten.
Beispiele Forschung und Entwicklung (Gentechnik, neue Züchtungsverfahren)
Senkung des Koffeingehalts. Manche Menschen möchten ihren Kaffee ohne Koffein trinken. Aber bei den heutigen Verfahren zur Entkoffeinierung gehen auch viele erwünschte Geschmacksstoffe verloren. Besser wäre es, wenn in der Kaffeebohne erst gar kein Koffein entstünde. Einige Forschergruppen arbeiten daran, solche Kaffeesorten zu entwickeln.
Das Startup-Unternehmen Tropic Biosciences in Großbritannien hat mit Hilfe von Genome Editing eine Kaffeesorte entwickelt, die koffeinreduzierte Bohnen liefert. Mit der Gen-Schere CRISPR/Cas schalteten die Beteiligten die Gene aus, die für die Koffeinproduktion in den Bohnen verantwortlich sind. Der Kaffee aus den editierten Kaffeebohnen soll besser schmecken, bessere Inhaltsstoffe enthalten und weniger kosten als herkömmlicher entkoffeinierter Kaffee.
Mit der RNAi-Technologie war es Forschern in Japan bereits 2003 gelungen, Kaffeepflanzen zu entwickeln, deren Koffeingehalt um bis zu 70 Prozent reduziert ist. Dabei wurden Gene blockiert, die bei der Bildung des Koffeins eine Rolle spielen. Die Pflanzen wuchsen jedoch schlecht und das Blockieren eines Enzyms führte zu unvorhersehbaren negativen Effekten.
Anpassung an veränderte Klimabedingungen. Arabica-Kaffee ist temperatur- und wetterempfindlich. Er wächst bevorzugt in den Bergregionen (um 1000 m) tropischer Zonen. Kommt es in Folge des Klimawandels zu höheren Temperaturen, längeren Trockenperioden oder kürzeren Regenzeiten, müssen die Kaffeeplantagen entweder in höhere Lagen ausweichen, wo sie artenreiche Regenwälder verdrängen, oder die Arabica-Bäume müssen mit den veränderten Bedingungen zurecht kommen. In großen Züchtungsprogrammen wird daran gearbeitet, angepasste Sorten zu entwickeln. Dabei hat der Einsatz von Genome Editing-Methoden den Vorteil, dass die Züchtung neuer Sorten deutlich schneller erfolgt als mit herkömmlichen Methoden. Eine Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass mit den neuen Methoden nur einzelne oder einige wenige Gene verändert werden können, die Anpassung der Pflanzen an klimatische Bedingungen jedoch über eine ganze Reihe von Genen gesteuert wird.
Resistenz gegen Kaffeerost (Hemileia vastatrix). Die wirtschaftlich bedeutendste Pilzkrankkeit im Kaffeeanbau ist der Kaffeerost. Gerade die Arabica-Bohnen sind davon bedroht. Da die genetische Variabilität der aktuell genutzten Sorten vergleichsweise gering ist, reagieren sie besonders empfindlich auf den Schadpilz. Derzeit wird versucht, durch Einkreuzen von besseren Resistenzeigenschaften aus anderen Sorten robusteren Arabica-Kaffee zu züchten, ohne die besonderen Geschmacksvorteile zu verlieren. Weitaus schneller und präziser wäre das mit Hilfe gentechnischer Verfahren und vor allem des Genome Editings möglich. Allerdings fürchten die großen Kaffeeanbauer-Verbände, dass die Verbraucher solche Sorten nicht akzeptieren.
Resistenz gegen Insekten wie Miniermotten oder Kaffeebohrer. In den 2000er Jahren fanden vierjährige Feldversuche in Französisch-Guyana mit gentechnisch veränderten Robusta-Kaffeepflanzen statt, die durch Übertragung von Bt-Genen resistent gegen die Miniermottenart Leucoptera coffeella waren. Aufgrund von Feldzerstörungen wurde der Versuch abgebrochen.
Seitdem haben sich weitere Projekte mit der Forschung zu insektenresistenten Bt-Kaffeepflanzen beschäftigt. Eine Forschergruppe aus Frankreich und Kanada hat beispielsweise das Bt-Gen cry1Ac künstlich hergestellt und in Kaffeesorten eingebracht. Die gentechnisch veränderten (gv) Pflanzen waren resistent gegenüber der Kaffeeminiermotte Perileucoptera coffeella.
In Mexiko hat ein Forschungsteam Kaffeepflanzen entwickelt, die resistent gegen den Kaffeebohrer (Hypothenemus hampei) sind. Mit Hilfe gentechnischer Methoden führten sie ein Bt-Gen in das Genom von Arabica-Kaffee ein und zogen die Pflanzen auf. Nach zwei Jahren entwickelten sich Früchte, die das insektentoxische Bt-Protein (Cry10Aa) enthielten. Fraßversuche (Bioassays) mit Larven des Kaffeebohrers zeigten, dass die gv-Pflanzen resistent gegen H. hampei sind. Außerdem wiesen die Bohnen weniger Schäden auf im Vergleich zu den Kontrollpflanzen.
Im Web
- Valencia-Lozano, E. et al. (2021): Coffea arabica L. Resistant to Coffee Berry Borer (Hypothenemus hampei) Mediated by Expression of the Bacillus thuringiensis Cry10Aa Protein. Front. Plant Sci. 12
- Leroy, T. et al. (2020): Genetically modified coffee plants expressing the Bacillus thuringiensis cry1Ac gene for resistance to leaf miner. Plant Cell Rep. 19(4):382-385
- Tropic Biosciences
- What ever happened to the naturally caffeine-free coffee plant? Decadent Decaf Coffee Company, 31.07.2017
- Ogita, S. et al. (2003) Producing decaffeinated coffee plants. Nature 423, 823
- Why the end of the world’s most popular coffee could be nigh. Chemical Engineering News, 12.02.2018
- Understanding GMOs: Genetic Engineering and the Future of Coffee. Daily coffee news, 29.01.2018