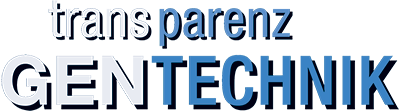Wie die Wissenschaftler den Kampf um die Deutungshoheit über die Kölner Petunien verloren
Am 14. Mai 1990 wurden auf dem Gelände des damaligen Max-Planck-Instituts für Züchtungsforschung in Köln 30.700 Petunien ausgepflanzt. Es war der erste Freilandversuch mit gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland. Mehrere Hundert Demonstranten blockierten das Tor zum Versuchsgelände. Politische Kampagnen, besorgte Bürger, diffuse Ängste und vor allem ein tiefes Misstrauen gegen eine Biologie, die Organismen nicht mehr nur beschreiben, sondern mit neuen, molekularbiologischen Verfahren auch verändern wollte - die Freisetzungen mit gv-Pflanzen in Deutschland begannen, wie sie gut 20 Jahre später endeten. Bis heute haben die Gentechnik-Gegner die Deutungshoheit behalten. Und daran sind die Petunien nicht ganz unschuldig.
Ich stand an diesem Tag zwar nicht vor dem Tor, aber ich gehörte zu den Gegnern des Petunienversuchs und beteiligte mich ein Jahr später aktiv am öffentlichen Erörterungstermin des zweiten Freisetzungsantrags (siehe unten). Das, was die Wissenschaftler am Institut konkret erforschen wollten, war uns – und mir – ziemlich egal. Wir waren dagegen, weil wir die Gentechnik – gleich ob bei Pflanzen, Bakterien oder am Menschen – grundsätzlich ablehnten. Die damals nach Tschernobyl und Seveso populär gewordene Kritik an Atom- und anderen Großtechnologien (Small is beautiful) haben wir einfach, ohne groß nachzudenken auf die Gentechnik übertragen.
Von Biologie und Genetik hatten wir keine Ahnung. Aber wir wähnten uns in unserem „ganzheitlichen Denken“ dem kalten, gegen „die Natur“ gerichteten Reduktionismus der Wissenschaftler überlegen. Wie sich gewöhnliche Petunien verhalten, ob sie Fremd- oder Selbstbestäuber waren, interessierte uns nicht. Dennoch glaubten wir besser zu wissen als die Züchtungsforscher am Institut, dass „die Folgen unabsehbar“ seien, wenn sie ihre gv-Petunien auspflanzten. Wenn ich mir heute vor Augen führe, wie wir uns im selbstgewissen Gefühl einer höheren Moral über die Wissenschaftler hinwegsetzten, welche persönlichen Verletzungen wir ihnen zufügten, schäme ich mich.
Was wir damals nicht wahrhaben wollten: Der Kölner Versuch war Grundlagenforschung, ohne konkreten Bezug zur kommerziellen Nutzung von gentechnisch veränderten Pflanzen, die ein paar Jahre später begann. In die Petunien war – neben dem aus technischen Gründen notwendigen Resistenz-Gen gegen das Antibiotikum Kanamycin – ein aus Mais isoliertes Gen für eine lachsrosa Blütenfarbe eingeführt worden. Der Zweck der Petunien war, „springende Gene“ (Transposons) und ihre Bedeutung in der Evolution näher zu erforschen. Während der Entwicklung eines Organismus wandern sie im Genom hin und her. Wenn sie in ein Gen „springen“, lösen sie dort Mutationen aus. Ist bei einer Petunie das Mais-Gen für die lachsrote Farbe davon betroffen, wird es zerstört und die betreffende Pflanze blüht weiß. Der Farbumschlag, so die Erwartung, sollte ein springendes Gen in Aktion anzeigen, um dort anschließend die molekularen Vorgänge genauer analysieren zu können.
Selbst den meisten Gegnern war insgeheim klar, dass das Petunienexperiment „ziemlich harmlos“ war. Ein auch nur halbwegs plausibles Szenario für das, was denn im schlimmsten Fall hätte passieren können, gab es nicht. Bekämpft wurden die Petunien als „politisches Pflänzchen“, als Türöffner und „Pilotprojekt für viel gefährlichere Tests“. Sie sollten, so argwöhnten Umweltschützer, die „Hemmschwelle bei der verunsicherten Bevölkerung gegenüber gentechnischen Experimenten senken.“ Die Grünen im Düsseldorfer Landtag wollten den „achten Tag der Schöpfung verhindern“ und warnten vor „bislang kaum bekannten und erforschten Risiken“. Und eine Demonstrantin vor dem Institutstor sagte in die Fernsehkamera: „Keiner weiß, was wirklich passiert mit dem genmanipulierten Material, das irgendwann in den Boden hineinkommt und aufgenommen wird von den anderen Organismen”. Kaum klare Argumente, dafür viel unheilschwangere Ahnungen – im Kern hat sich dieses Muster bis heute gehalten. Solche diffusen Befürchtungen haben sich im grün-ökologischen Milieu inzwischen zu „Wahrheiten“ verfestigt. 25 Jahre mit mehreren Zehntausend Freisetzungsversuchen mit gv-Pflanzen in aller Welt und bald 20 Jahre Anbau auf zuletzt 180 Millionen Hektar im Jahr (2014) haben daran kaum etwas ändern können.
Doch die Geschichte der Kölner Petunien hat noch eine Pointe. Dass Transposons in ein bestimmtes Gen – in diesem Fall das Gen für die lachsrote Farbe – springen, ist ein äußerst seltenes Ereignis. Die Kölner Wissenschaftler um Institutsdirektor Heinz Saedler hatten daher erwartet, dass nur ganz wenige ihrer Petunien weiß blühen würden. Doch es kam anders: Mehr als die Hälfte aller Blüten waren weiß mit einigen roten Sprenkeln.
Die Häme war groß. „Ein interessanter Flop“ titelte die Zeit, „Fiasko in Farbe“ der Spiegel. Für die Gegner war es der Beweis für die Unberechenbarkeit der Natur. Der Anspruch der Gentechniker, die Folgen ihrer „Manipulationen“ beherrschen zu wollen, schien für alle sichtbar widerlegt. „Nicht auszudenken“, erregte sich die Grüne Landtagsabgeordnete Katrin Grüber, „was auf uns hätte zukommen können, wäre der Freilandversuch mit weniger harmlosen Lebewesen durchgeführt worden.“
Zunächst dachte ich auch so. Die unerwartet weißen Petunien passten einfach zu gut ins Bild einer sich selbst überschätzenden und damit unkontrollierbaren Gentechnik. Für die Gegner war es einfach, das überraschende Ergebnis in ihrem Sinne zu deuten. Es war der offensichtliche Beweis, dass sie recht hatten. Dagegen hatten die Wissenschaftler kaum eine Chance, mit ihrer Deutung Gehör zu finden. Und das wirkt bis heute nach.
Erst einige Jahre später – nachdem ich mich viel intensiver mit dem Thema beschäftigt hatte und mir die immergleichen Angstkampagnen fragwürdig geworden waren – konnte ich besser begreifen, was sich auf dem Kölner Petunienfeld abgespielt hatte – ein Versuch, der zu einem bedeutenden wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn führte. Anfangs konnten die Wissenschaftler den massenhaften Farbumschlag nicht erklären. Aber dann, als sie in den weißblühenden Petunien die molekularen Veränderungen am Mais-Gen genauer analysierten, fanden sie etwas Erstaunliches heraus: „Methylgruppen“ hatten sich auf das Gen gesetzt und so die Bildung der lachsroten Farbe blockiert. Das Farb-Gen war völlig intakt, dennoch blühten die betroffenen Pflanzen weiß. Nicht Transposons waren dafür verantwortlich, sondern eine Methylierung der DNA, eine stoffliche Struktur, die die Genaktivität beeinflusst. Und – das war damals eine wirklich neue Erkenntnis: Umweltfaktoren können auf diesem Weg die Aktivität von Genen beeinflussen – im Fall der Kölner Petunien war eine extrem heiße, trockene Wetterperiode mit hoher UV-Einstrahlung dafür verantwortlich. Inzwischen kennt man verschiedene solcher „epigentischen Effekte“ – Mechanismen, die nicht in Genen festgelegt sind, aber dennoch Genaktivitäten steuern.
Das unerwartete Ergebnis des Kölner Versuchs führte zu einem neuen Forschungsgebiet der molekularen Analyse epigenetischer Phänomene. Und Peter Meyer, der für den Petunien-Versuch verantwortliche Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts, wurde wegen dieser Arbeiten als Professor an die Universität in Leeds berufen. Das scheinbar gescheiterte Kölner Experiment steht am Beginn eines neuen Forschungszweigs.
Eigentlich ist es mit den Kölner Petunien genau anders herum als in den Erzählungen der Kritiker: Der Versuch zeigt, wie Wissenschaft funktioniert und welche Qualität wissenschaftliches Denken hat. Zunächst wurde eine Hypothese aufgestellt – Transposons lösen Mutationen aus – und dann ein geeignetes Versuchsdesign – Petunien mit einem Farb-Gen – entwickelt, um sie überprüfen zu können. Das Ergebnis entsprach zwar nicht den Erwartungen, aber führte zu wichtigen neuen Erkenntnissen, welche das Wissen um Genregulation und die Rolle von Umwelteinflüsse erweitert haben. Im Labor wäre das nicht möglich gewesen, nur im Freiland mit seinen Launen des Wetters.
Aber, heute bedauere ich das, leider haben nicht die Wissenschaftler den Kampf um die Deutung des Petunienversuchs gewonnen, sondern die Gentechnik-Gegner. Grundlagenforschung an und mit gentechnisch veränderten Pflanzen gibt es in Deutschland allenfalls noch im Labor und Gewächshaus, im Freiland schon seit einigen Jahren nicht mehr.
*
Im Mai 1989 wurde der Antrag des Kölner Max-Planck-Instituts für Züchtungsforschung auf einen Freilandversuch mit gentechnisch veränderten Petunien durch das damalige Bundesgesundheitsamt genehmigt. Rechtsgrundlage waren die „Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in-vitro neukombinierte Nukleinsäuren vom 28.05.1986“. Wegen der verspätet erteilten Genehmigung wurde der Versuch um ein Jahr verschoben.
Am 14.Mai 1990 wurden 37.000 gv-Petunien in Köln-Vogelsang ausgepflanzt. Die Initiative „BürgerInnen beobachten Petunien“ protestierte vor dem Eingangstor zum Institut.
Nach dem überraschenden Ergebnis des Versuchs beantragte das MPI einen zweiten Freilandversuch, um den Farbumschlag (Methylierung) genauer untersuchen zu können. Inzwischen war das erste Gentechnik-Gesetz in Kraft getreten. Dieses schrieb für beantragte Freisetzungsversuche einen öffentlichen Erörterungstermin vor, auf dem die eingelegten Einsprüche – im Fall der Petunien waren es 1600 – verhandelt werden sollten. Diese fand Anfang 1991 in Köln statt, über zwei Tage wurden dort überwiegend formale Fragen behandelt.
Bis 1990 wurden nach einer Aufstellung der damaligen Gesellschaft für genbiologische Forschung weltweit 126 Freilandversuche mit gv-Pflanzen durchgeführt, davon 60 in den USA und 41 in Europa.
Diskussion / Kommentare
 Kommentare werden geladen…
Kommentare werden geladen…
Themen
Von: Gerd Spelsberg
Im Web
- Ein interessanter Flop, Die Freisetzung genmanipulierter Petunien endete mit Überraschungen; Die ZEIT, 16.11.1990
- Fiasko in Farbe, SPIEGEL, 16.11.1990
- Peter Meyer et. al., Endogenous and environmental factors influence 35S promoter methylation of a maize A1 gene construct in transgenic petunia and its colour phenotype; MGG, February 1992, Volume 231, Issue 3
- Center for Plant Science, University of Leeds; Plant epigenetics / Prof. Peter Meyer